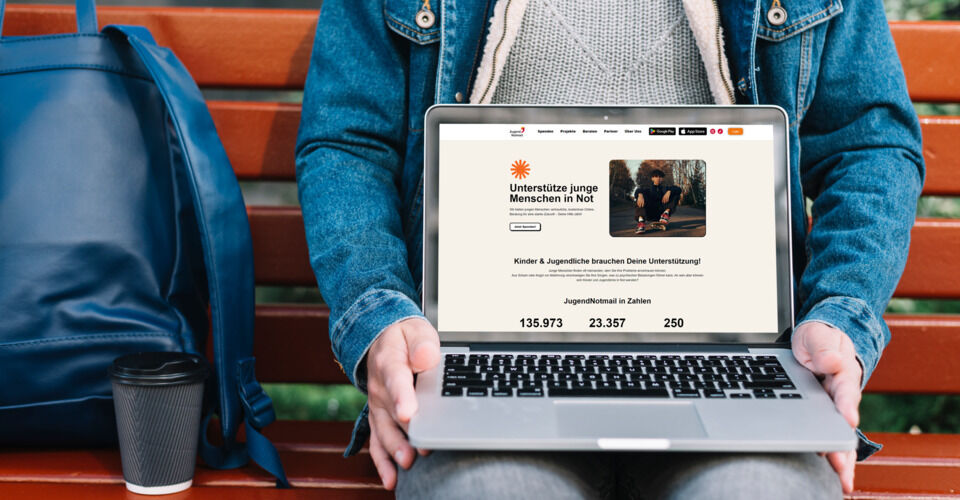Mareike Fell war viele Jahre als Schauspielerin erfolgreich, bevor sie ihre eigene Praxis für systemische Einzel‑, Paar- und Familientherapie in Hamburg Blankenese eröffnete. Zudem ist sie als Beraterin und Trainerin an einem renommierten Institut für externe Mitarbeiterberatung tätig und sitzt im wissenschaftlichen Beitrat des Portals „einfach-eltern.de“. Sie sagt: „Resilienz vermehrt sich, je mehr wir sie benutzen”! In ihrem Gastbeitrag wirft sie mit uns einen spannenden Blick auf Eltern-Kind-Beziehungen und ‑situationen im Alltag.
„Frau Fell, wie wird mein Kind endlich so, wie ich es mir wünsche? Selbstbewusst, eigenständig und mit gesundem Selbstvertrauen.“
Ich frage dann zurück: “Sind Sie denn selbstbewusst? Wieviel trauen Sie Ihrem Kind zu? Sind Sie mutig genug, ihrem Kind nicht zu helfen?“
„Wie‚ nicht helfen? Aber ich werde mein Kind doch nicht fallen lassen!“
Das meine ich damit auch nicht. Ich erlebe in meiner Praxis oft sehr ambivalente und auch hilflose Eltern. Einerseits wollen sie, dass die Kinder später selbstbewusst und eigenverantwortlich sind, ausgestattet mit einem gesunden Selbstvertrauen. Man könnte auch sagen: Sie sollen resilient sein. Andererseits macht es vielen Eltern große Angst, die Grundlagen für genau diese Eigenschaften zu legen. Nun ist Resilienz etwas, was wir nicht in einer Tüte kaufen können. Resilienz ist das Ergebnis eines ganz bestimmten Denkens, Fühlens und Handelns. Eine Schwingungsfähigkeit, die es uns erlaubt, wie die Weide im Wind mitzuschwingen anstatt zu brechen.
„Grundsätzlich bringen Kinder eine natürliche Resilienz mit — versteckt in all den Eigenschaften, die Eltern wahnsinnig machen…”
Grundsätzlich bringen Kinder eine natürliche Resilienz mit — versteckt in all den Eigenschaften, die Eltern wahnsinnig machen: Nehmen wir die kleinen Chaoten, die ihre Eltern zur Weißglut bringen — perfekt! Sie orientieren sich ständig neu. Werden sie in Zukunft vor einem Problem stehen? Wohl kaum. Sie werden sich einfach neu orientieren und anpassen. Das kennen sie. Probleme kennen sie nicht. Oder die Kinder, denen alles egal ist. Sie werden niemals wegen Burnout bei mir sitzen, denn sie haben eine ganz natürliche „Egal-Kompetenz“, wie ich gerne sage. Oder diese „Trotz-Gören“, die in ständigem Widerstand leben. Sie machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Der Trotz ist einer der kraftvollsten Anteile — in jedem von uns. Um diese Kinder mache ich mir keine Sorgen. Sie sind stark.
„Mein Kind will nur tun, wozu es Lust hat. Das geht doch nicht!“
Klar, das klingt natürlich völlig unvernünftig. Aber auch das ist eine Kompetenz, die ich vielen Erwachsenen – und dabei erstaunlich vielen Müttern — erst wieder beibringen muss: sich Lust und Freude zu erlauben. Sie merken schon: Eigentlich sind Kinder resilient. Und jeder von uns war es einmal. Was also ist passiert? Ich habe verschiedene Ursachen ausgemacht, die diese uns angeborene Resilienz verstummen lässt. Ganz vorne weg sind es unsere hohen Familienideale, die Menschen überfordern und den Alltag so anstrengend machen: Man darf als Mutter oder Vater nicht rumschreien. Man muss ruhig bleiben. Immer. Zen-artig, fast unmenschlich verständnisvoll. Man darf vor den Kindern nicht streiten. Man darf aber auch nicht heimlich streiten. Eigentlich soll man doch vor den Kindern streiten, muss aber dann ein friedliches Ende finden. Man muss in einem Ehebett schlafen. Man muss den Kindern Struktur geben. Man muss viel qualitativ hochwertige Zeit mit den Kindern verbringen. Man muss als Familie alles gemeinsam machen. Man muss immer für die Kinder da sein. Man darf nicht egoistisch sein. Eigentlich muss man sich für die Familie aufgeben. Und dann sitzt bei mir die Mutter mit zwei Kindern, alleinerziehend, und versucht, all dies einzuhalten. Der Druck für sie ist noch größer, weil sie sich ja getrennt hat. Aber dieser Mutter geht es nicht gut. Sie zerbricht an ihren hohen Familienidealen. Sie wird dünnhäutig und schreit die Kinder an, fühlt sich deswegen schlecht und hat Schuldgefühle. Sie kann nicht mehr. Willkommen im Mutter-Burnout. Resilientes schwingungsfähiges Verhalten ist das nicht. Es ist an bürgerliche Vorstellungen angepasstes Verhalten.
„Aber ich muss doch für meine Kinder da sein.“
Wenn man resilient ist, tut man, was gerade gebraucht wird und was möglich ist — nicht, „was man tun muss“. Ruhe kommt bei dieser Mutter ins System, als ich gemeinsam mit ihr alles, was nicht geht, streiche. Sie badet die Kinder nur noch einmal die Woche. Sie erlaubt sich ab und zu mit ihnen Pizza vor dem Fernsehen zu essen. Sie regt sich nicht mehr über die Unordnung in der Küche auf. Ihr ist egal, was die anderen sagen. Sie zeigt den Kindern ihre eigenen Grenzen auf, indem sie sagt, dass sie keine Kraft zum Spielen hat, sondern einfach mal gar nichts machen möchte. Kinder können das aushalten. Sie fühlen sich nur schuldig, wenn sich die Eltern für sie aufgeben. Und mit der Ruhe der Mutter werden auch die Kinder wieder ruhig, denn Kinder spüren, wenn Eltern schwach werden. Und das macht ihnen Angst. Dann tragen Kinder die Last der Eltern – und das ist das Letzte, was liebende Eltern wollen. Kinder wollen, dass Eltern sich gut um sich selbst kümmern. Sie wollen unter dem Radar fliegen. Nicht im Fokus stehen und wichtige Entscheidungen treffen müssen. Viel lieber wollen sie auch mal gegen wichtige Entscheidungen der Eltern sein dürfen. Was weiter Resilienz bei Kindern verhindert, ist die Angst der Eltern. Die Angst, dass die Kinder nicht ins System passen, wenn sie sich nicht anpassen, dass aus ihnen ‚nichts wird.‘
„Ich will doch nur das Beste für mein Kind.“
Es ist das, was mir in meiner Praxis immer wieder begegnet: Die Kinder dürfen heute im Grunde alles, werden in jeder Hinsicht unterstützt — aber versagen dürfen sie bitte nicht. Denn das macht den Eltern ja Angst. Das eigentliche Problem ist, dass wir Eltern es nur schwer aushalten können, wenn Kinder den schwierigen Weg gehen. Es braucht also als Gegenspieler der Angst ein tiefes Vertrauen: In unser Kind, dass es seinen Weg schon gehen wird. Aber auch in uns, dass wir es doch bisher auch gut geschafft haben.
Wie entsteht denn dieses Vertrauen?
Ist es nicht der Glaube daran, dass wir beschützt sind? Und dass jeder von uns die Lösung für sein Problem bereits in sich trägt. Wo stehen Sie denn heute? Wo kommen Sie her? Waren die Umwege nicht eigentlich die wichtigen Momente in Ihrem Leben? Und die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gab, die wahren Momente des Lernens? Denn um stark zu werden für Krisen braucht es: Krisen! Probleme! Resilienz hat eine wundervolle Eigenschaft: Sie wird mehr, je mehr wir sie benutzen. Sozusagen ein Engelskreis statt eines Teufelskreises. Mit Teufelskreis meinen wir ja, dass alles immer schlimmer wird und man aus diesem Kreis nicht mehr rauskommt. Man ist gefangen im Teufelskreis. Im Engelskreis dagegen befruchten sich die gefundenen Lösungen immer weiter, es entsteht ein sich selbst verstärkendes Kraftfeld. Dazu braucht es von klein auf Krisen und Probleme, die das Kind zeternd und wetternd bewältigen darf, damit die Resilienz wächst und das Kind die Wirkung des Engelskreises spürt.
Und genau dann erleben wir immer häufiger, dass wir ein Problem bewältigen können. Aus einem verzweifelten: „Das hat ja noch nie geklappt“ wird zunehmend ein selbstbewusstes „das hat ja schon mal geklappt“. Es vermehrt sich auf wundersame Weise und wird zum Engelskreis. Der Anstoß ist gesetzt um dann auch in Zukunft mehr und mehr lösungsorientiert zu denken. Dabei erlebt man sich als selbstwirksam, und daraus wächst dann tiefes Selbst-Vertrauen. Nur wenn wir uns neu und anders verhalten, lernen wir neue passendere Kompetenzen als die bisherigen. Also raus aus der Komfortzone! Das gilt auch und gerade für die Kinder.
„Soll ich etwa mein Kind mit seinen Problemen alleine lassen?“
Kinder werden resilient, wenn sie in jedem Alter ihre Probleme selbst erleben und lösen dürfen. Dann werden sie später zu schwingungsfähigen Erwachsenen, die an Krisen nicht zerbrechen. Wenn das Kind aktiv und eigenständig Lösungen gestalten darf, fühlt es sich nicht mehr ohnmächtig und ausgeliefert, sondern erlebt sich kraftvoll und selbst-bewusst. Als Eltern den Raum zu geben für diese Selbsterfahrung kann heißen, dass das Kind ohne Jacke aus dem Haus darf, obwohl es sehr kalt ist — die Jacke ist aber natürlich als Sicherheit im Gepäck… Das Kind darf hier seine Erfahrung, zu dünn angezogen zu sein, selbst machen, woran die Eltern beim nächsten Mal vermutlich nur noch zu erinnern brauchen. In höherem Alter ist die Schule ein spannendes Lernfeld für Eltern, die Selbstwirksamkeit der Kinder zu ertragen: Oft übernehmen sie die Verantwortung für Hausaufgaben, Lernen, Ranzen packen und Termine — die Schule muss ja laufen, hier lauert die Angst. Das Kind soll es genau so machen, erlebt sich aber ohnmächtig und geht — Überraschung — in den Widerstand. Je früher Eltern hier die Verantwortlichkeiten für die Schule dem Kind selbst übertragen, desto eher wird es in die Verantwortung gehen. Auf diesem Weg auszuhalten, wenn es stolpert, auszuhalten, wenn die Noten mal einfach nicht gut sind oder das Kind zu spät zur Schule kommt und die Folgen in aller Konsequenz dem Kind zu lassen, ist die eigentliche Herausforderung für die Eltern.
Eltern dürfen also leider nicht „helfen“, denn wenn sie Teil der Lösung sind, ist es nicht die selbst erbrachte Lösung des Kindes, es ist nicht seins. Nun kann es aber sein, dass das Kind schreit und weint und leidet — es geht ihm in der Krise fürchterlich und es fleht um Hilfe! Und natürlich wollen wir einschreiten und helfen — ich kann das so gut verstehen. Für das Kind ist es ja auch unbequem, selbst auf Lösungen kommen zu müssen, Gefühle des Frustes, der Wut und Begrenzungen aushalten zu müssen. Darauf hat doch keiner Lust. Daher wird Kindern diese Erfahrung aus Mitleid (oder aus Angst) gerne genommen. Dabei ist genau dies der Moment des Resilienz-Trainings! Stattdessen wird dem Kind erklärt, warum etwas Sinn macht, in der verrückten Annahme, dass das Kind dann plötzlich versteht und Lust dazu hat. Aber wie wäre es, das Kind Dinge, die zu tun sind, einfach ohne Lust tun zu lassen? Oder mit Angst? Vielleicht sogar „Trotz-dem“? Wären Eltern im Vertrauen in sich und das Kind, würden sie akzeptieren, dass es dem Kind keinen Spaß machen muss, dass das Kind nicht Hurra schreien muss, dass es schreien und zetern darf, wenn etwas getan werden muss — denn diese Eltern wissen, dass es nur so lernt, mit all den Gefühlen und Problemen umzugehen.
„Aber wie jetzt, Frau Fell: Ich soll mein Kind fallen lassen?“
Nein. Ganz im Gegenteil. Wo ist nun die Grenze zum fallen-lassen? Wo müssen wir sehr wohl helfen? Denn natürlich gibt diese Grenze, wo eine Herausforderung für ein Kind zu groß ist. Genau diese Grenze kann nicht allgemein genannt oder gar an einem Alter festgemacht werden, sondern ist von der individuellen kindlichen Entwicklung abhängig. Sie kennen ihr Kind selbst am besten! In den Momenten, wo es schwierig wird, kann Ihnen die folgende Frage bei der Orientierung helfen: „Traue ich meinem Kind dieses Problem zu?“ Wenn die Antwort in unserem Kopf ist: „Ja, das kann es sehr wohl schaffen“, dann ist dies ein hervorragender Moment um resilientes Denken, Handeln und Fühlen zu üben und zu lernen. Es wird dann Teil des Kindes, weil es sich diese Art zu denken selbst erarbeiten durfte. Es übt, mit all den Emotionen, die es in diesem Moment überkommen, umzugehen. Ein wahrer Moment der Frustrationstoleranz. Hilfreich ist es gemeinsam mit dem Kind herauszufinden, was es braucht, damit es die aktuelle Krise oder das Problem selbst bewältigen kann. Wir begleiten es in seiner Lösungssuche: „Unter welcher Bedingung würde das klappen? Was brauchst du dazu, mein Kind? Du bist die Expertin Deines Problems!“ Wichtig dabei ist: Ich darf als Kind auch stolpern und mal so richtig versagen, ohne dass die Eltern in Angst geraten. Das Kind spürt: Meine Eltern vertrauen darauf, dass ich das schon schaffe. Hier kann ich mich als Kind anlehnen und Sicherheit tanken, selbst, wenn mich mein kindliches Problem gerade sehr herausfordert.
„Dann darf mein Kind machen, was es will?“
Nein, das wäre Vernachlässigung und Alleinlassen. Ich möchte Ihnen zur Orientierung ein Bild geben: Stellen Sie sich einen Gang mit vielen Türen vor. Manche Türen führen ins Nichts, andere führen in weitere Gänge mit weiteren Türen. Wir Erwachsene wissen um die Türen — das Kind, was gerade in diesem Flur steht, nicht. Nun geht es los und probiert die Türen aus. Es ist unsere elterliche Verantwortung, ihm jetzt zu sagen, wo es besser nicht durch geht — und wo es weiter gehen kann. Dabei ist es OK, wenn das Kind sauer ist, weil es nicht durch diese eine Tür gehen soll. Wir schreiben auch nicht einfach vor, wo es lang geht, denn dann geht das Kind in den Widerstand. Will es unbedingt durch eine Tür, lassen wir es gehen — und sind die sichere Stimme im Hintergrund, wenn es zurückwill, weil es erkannt hat, dass es tatsächlich nicht geht. Aber es darf durch die Tür. Gleichzeitig begleiten wir es dabei, wie es denn nun weiter machen will, wenn es sich verlaufen hat. Was braucht es, damit es das nächste Mal die richtige Tür findet? Im Laufe der Zeit wird das Kind dann von selbst erkennen, welche Türen gut sind und welche nicht. Es wird durch seinen reichen Erfahrungsschatz an falsch gegangenen Wegen auch wissen, wie es von allein zurückkommt. Vielleicht entdeckt es aber auch Türen, die Sie sich selbst nie getraut haben, zu öffnen. Das wird das resiliente Kind sein, was sicher durch sein Labyrinth des Lebens finden wird — eventuell ein ganz anderes als Ihres.

Mareike Fell ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Einzel- Paar und Familienberaterin. Neben ihrer Praxis „die Sinnstiftung“ ist sie für ein führendes Institut in der externen Mitarbeiterberatung tätig, hält Vorträge und Seminare und schreibt in Kolumnen und Beiträgen rund um das Thema psychische Gesundheit, Kindererziehung und Elternberatung. Sie sitzt im wissenschaftlichen Beirat von „einfach Eltern“ und Mitglied im VfP.
Mehr unter: www.diesinnstiftung.de
Bild: © Jacobia Dahm, Mareike Fell
„Der gesamte Beitrag ‚Wie wir Resilienz bei Kindern fördern können‘ steht im Buch ‚Sternstunden im Alltag‘ von Jost Wetter-Parasie und Luitgardis Parasie, Brunnen Verlag Gießen 2024.