Prof. Dr. Volker Busch ist Arzt, Wissenschaftler, Autor und Vortragsredner und darf sich mit seiner Leidenschaft beschäftigen, wie er selbst sagt: der Welt von Geist und Gehirn. In seiner Brust schlagen zwei Herzen: Einerseits erforscht er als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Regensburg mit seinem Team die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen bzw. arbeitet therapeutisch mit Menschen, die unter Belastungen verschiedenster Art leiden und begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit und Zufriedenheit. Andererseits gibt er seit vielen Jahren sein Wissen und seine Erfahrung in Form von Keynotes/Vorträgen, Seminaren und Publikationen weiter, und hilft Führungskräften, Mitarbeitern und seinen Mitmenschen zu mehr Gehirngesundheit, Motivation und Inspiration. Wir durften mit ihm sprechen…
Viele stellen sich die Frage: “Darf ich angesichts des Leids in dieser Welt glücklich sein?” und tragen einen gewissen “Weltschmerz” auf den Schultern. Was sagen Sie Ihren Leserinnen und Lesern? Was belastet denn die menschliche Psyche nun genau und warum ist das schlecht für unser Gehirn?
Wir sind als Menschen eine Spezies, die immer nach vorne in die Zukunft schaut. Es gibt Autoren, die den „Homo sapiens“ schon mal als „Homo Prospectus“ bezeichnet haben, also als Wesen, das ständig nach vorne schaut. Nach gewissen Studien schauen wir alle drei Minuten nach vorne, zwar nicht weit, aber dafür häufig. Durch diesen Blick nach vorne haben wir das Gefühl, Sicherheit zu empfinden. Wir wollen uns vorbereiten und Gefahren rechtzeitig erkennen, um ihnen aus dem Weg zu gehen. All das ist sehr typisch für uns. Wenn wir in Zeiten, wie aktuell, nach vorne blicken und ganz viele Sorgenwolken bezüglich Inflation, Migration oder der schrecklichen Kriege am Rande Europas und im Nahen Osten am Himmel sehen, ist der Blick von unserer Zukunft natürlich eher negativ. Dann kommt es zu dem, was wir Bedrohungserwartung nennen und für den Menschen eine unglaubliche Belastung ist. Der Mensch braucht eine positive Aussicht, um sich wohlzufühlen! Er braucht einen klaren Blick in die Zukunft, um gegebenenfalls rechtzeitig Dinge in die Wege leiten zu können. Das alles ist nicht möglich. Wir wissen nicht, was kommt. Das empfinden wir als belastend und unzuverlässig und gleichzeitig hindert es uns daran, Gefahren anzupacken.
“Wir müssen uns bewusst machen: Der Mensch braucht eine positive Aussicht in die Zukunft, und zwar in allen Bereichen: beruflich wie privat. Wenn diese fehlt, ist das belastend.”
Ich habe in erster Linie Patienten, die mit privaten Sorgen zu mir kommen, weil zum Beispiel Partnerschaften nicht mehr funktionieren, wegen Problemen im Job oder mit der Gesundheit. Da ist es genauso. Es ist gar nicht so entscheidend, ob jemand ein Symptom oder Schmerzen, sondern ob man einen Horizont hat. Wenn ich das als Arzt geben kann, kann er oder sie das Problem viel besser bewältigen. Wenn das aber nicht der Fall ist und man nicht weiß, was auf einen zukommt, ist das die absolute Katastrophe – wie zum Beispiel, ob nun ein Biopsie-Befund positiv oder negativ ist. Wir müssen uns bewusst machen: Der Mensch braucht eine positive Aussicht in die Zukunft, und zwar in allen Bereichen: beruflich wie privat. Wenn diese fehlt, ist das belastend. Darunter leiden aktuell auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land. Sie könnten mit hohen Strompreisen oder Abgaben durchaus zurechtkommen, wenn ihnen von der Politik mehr Verlässlichkeit suggeriert würde und sie wüssten, woran sie sind. Aber da es so ein Hü und Hott und Vor und Zurück ist, ist die Zukunftsaussicht so unwägbar und unklar, und das ist einfach belastend.
Wie beantwortet man sich die Frage, ob ich denn selber überhaupt noch glücklich sein darf, wenn es mir doch noch gut geht im Vergleich zu anderen Ländern?
Das ist ein guter Punkt und, glaube ich, auch richtig beobachtet. Wir haben zwar im Vergleich zu anderen deutlich mehr, was Gesundheit, Hygiene, Wohlstand und Sicherheit angeht, als vergleichsweise andere Länder oder Völker auf der Erde, aber wir haben eben auch vergleichsweise mehr zu verlieren, weil wir von einem höheren Stand zu fallen drohen. Und das ist der Punkt: Glück ist ja nie ein absolutes Empfinden, sondern immer relativ zu dem, was man selbst schon hatte, kannte oder was andere haben. Glück entsteht immer aus der Relation, leider immer aus dem Vergleich. Das ist nicht besonders charmant und schön, aber es ist so. Und wenn die Zukunft verspricht, bald weniger von dem zu haben, was wir gerade noch gewohnt waren, bedeutet das Unglück. Es bedeutet aber ebenfalls Unglück, wenn die Zukunft verspricht, dass wir weniger haben werden als jemand anderes. Leider messen wir uns immer an dem, was schon war, und an dem, was andere haben. Das ist diese Relation. Und deswegen haben es unsere saturierten Gesellschaften verhältnismäßig schwer, in der jetzigen Zeit mit dem Ausblick nach vorne noch genauso glücklich zu sein, wie wir es in den letzten satten 30 Jahren gewohnt waren. Und umgekehrt ist es so, dass Gesellschaften, die nicht so viel haben und seit Jahrzehnten von der Hand in den Mund leben und häufiger mit weniger auskommen müssen, vielleicht sogar wirklich große Entbehrungen tagtäglich erfahren müssen, sich mit Krisen oft gar nicht so schwertun, weil die Fallhöhe nicht so hoch ist. Das Ausgangsniveau, von dem sie runterfallen und von dem ihnen die Krise einfach so die Beine wegzieht, ist nicht so hoch wie bei uns. Das muss man verstehen. Man kann es als Jammern abtun, aber es erklärt sich psychologisch aufgrund unserer sehr, sehr hohen Fallhöhe, von der wir herunterzufallen drohen.
„Zufriedenheit ist eine Ressource, die uns Energie und Kraft gibt, mit unserem Leben weiterzumachen!“
Und hinsichtlich des zweiten Teils der Frage, ob wir uns noch glücklich fühlen dürfen, vertrete ich als Psychiater die Meinung: Absolut ja! Wir müssen oder sollten es sogar, denn nur wenn wir uns auch in schwierigen Zeiten glückliche Momente bewahren, können wir überhaupt Kraft schöpfen, mit unserem Leben weiterzumachen. Wenn wir die ganze Zeit nur unglücklich sind und jammern über das, was mal war und uns verloren gegangen ist oder was in Zukunft vielleicht nie wieder so wird, wie gefühlt früher, machen wir uns das Leben schwer und fühlen uns nicht nur schlechter, sondern uns fehlt auch die Kraft, rauszugehen und unsere Frau oder unseren Mann zu stehen. Glück im Sinne von Zufriedenheit ist also nicht nur ein Wohlfühlaspekt, sondern auch eine wichtige Ressource. Zufriedenheit ist eine Ressource, die uns Energie und Kraft gibt, mit unserem Leben weiterzumachen und eben trotz Rückenschmerzen und Problemen mit Kindern, Freunden oder Partner oder trotz finanzieller Sorgen das Leben so gut es geht zu leben. Dafür brauchen wir Gefühle wie Zufriedenheit und Wohlbefinden und deswegen ist mir das sehr wichtig.
Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht manchmal ein bisschen herzlos auf andere oder auch für einen selbst wirkt es vielleicht sympathischer, wenn man sich die ganze Zeit mit dem Leiden gemein macht, aber das ist nicht richtig. Wir sehen das in den Pflege- oder überhaupt sozialen Berufen, dass dort, wo sie sich rührend um die Schicksale anderer Menschen kümmern, dieser wichtigen Tätigkeit überhaupt nur nachgehen können, wenn sie immer wieder zu sich selbst zurückfinden, Freude im Leben haben, sich ablenken und sich in der Freizeit mit etwas anderem beschäftigen, was sie glücklich macht und wo sie lachen und Freundschaften genießen. Alles andere führt ins Burnout. Das wissen wir sehr gut. Die Erschöpfung am Arbeitsplatz entsteht durch diese Einseitigkeit im Leben, dass man seine gesamte Kraft in ein kaum oder unlösbares Problem steckt, an dem man dann letztendlich zerbricht und irgendwann ausbrennt. Zu viel Hilfeleistung, zu viel Mitleid und zu viel Empathie klingt erst mal großartig, menschlich und toll, aber ist im Grund kein sinnvoller Umgang mit Energie, sondern brennt uns aus. Bei Ärzten, Lehrern und Polizisten sehen wir das, die diesbezüglich schwere Jobs haben. Sie brauchen die Phasen, in denen sie sich von der Welt abkapseln und wo das alles keine Rolle spielt und sie nur mal Spaß und Freude haben und alles um sich herum vergessen. Das dürfen wir als Gesellschaft auch in schwierigen Zeiten.

Bild: © Prof. Dr. Volker Busch, Fotograf: Oliver Reetz
Sie sind renommierter Psychiater und Neurowissenschaftler und betonen, wie wichtig ein stabiles mentales Immunsystem in Krisenzeiten ist, wie man es stärkt und warum die Sorge um die eigene psychische Gesundheit gerade kein Luxusphänomen ist. Wie entsteht ein mentales Immunsystem? Ist es genetisch bedingt oder „anerzogen“?
Das mentale Immunsystem als Begriff ist ja ein Sprachbild, mit dem ich versuche, ein psychisches Abwehr- und Verteidigungssystem zu beschreiben, was wir in der Tat alle haben – wahrscheinlich im Gehirn. Wenn wir auf die Welt kommen und wachsen, bringt dieses System bereits gewisse Fähigkeiten mit. Am Anfang ist es noch relativ wenig ausgeprägt, entwickelt sich aber sehr schnell. Sehr schnell lernen wir beispielsweise zu sprechen, unsere Bedürfnisse zu verbalisieren oder Gefühle in den Griff zu bekommen. Wir weinen nicht mehr sofort, wenn etwas passiert. Als kleines Kind haben wir schnell geschrien, später kann man die Gefühle dann auch mitnehmen, bewältigen und darüber nachdenken, bevor man aus sich herausgeht, oder darüber sprechen. Das alles sind sehr banale und selbstverständlich scheinende Aspekte, sind aber doch große Kompetenzen im Umgang mit psychischen Befindlichkeiten. Dann kommt Lebenserfahrung dazu, Aufgaben, an denen wir wachsen oder auch mal scheitern – aber durch die wir lernen. Das könnten Fälle sein, wie die Frage, wie wir als Schulkind zum Beispiel nach Hause kommen, wenn der Bus ausfällt, oder auch eine Nacht alleine ohne Eltern zu Hause zu sein, oder wie es ist, wenn wir die Klasse oder den Wohnort wechseln, weil Mama oder Papa in einer anderen Stadt einen neuen Job bekommen haben. Das sind zwar normale Dinge des Alltags, aber gleichzeitig auch wichtige Lernerfahrungen, durch die ich Aufgaben und Zustände bewältige. Durch all diese Dinge wächst mein mentales Immunsystem, also meine Fähigkeit, psychische Belastungen abzuwehren.
Das ist ähnlich wie das körperliche Immunsystem, das durch die fortwährende Auseinandersetzung mit neuen Krankheitserregern im Prinzip stärker wird. Irgendwann in Zukunft erinnert er sich an die Krankheitserreger und kann diese dann beispielsweise durch die Produktion von Antikörpern schneller abwehren. So ist es bei dem mentalen Immunsystem auch. Wenn ich mal gelernt habe, was Liebeskummer ist oder wie es ist, Mobbing ausgesetzt zu sein oder eine eigene Wohnung zu beziehen, dann sind das Lernerfahrungen, die mich stärker und stabiler machen. Das führt bestenfalls dazu, dass wir im Laufe unseres Lebens immer stärker werden und mit Krisen immer besser umgehen können. Ich habe in dem aktuellen Buch eine Studie darüber zitiert, dass ein Mensch in seinem Leben im Schnitt fünf große Krise hat, aber diese im Laufe des Lebens leichter werden. Nicht, weil die Krisen oder die Ursachen geringer werden, sondern weil wir stärker werden. Wir werden etwas gelassener im Umgang mit den Krisen. Das zeigt schon sehr, dass das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses ist, dass es uns psychisch im Laufe des Lebens stärker macht. Dennoch ist es Grenzen unterlegen. Natürlich gibt es auch Einflüsse, die dazu führen können, dass Menschen komplett den Boden unter den Füßen verlieren und so schwere Narben davontragen, dass sie nicht stärker, sondern schwächer werden. Denken wir an posttraumatische Belastungsstörungen, das gibt es selbstverständlich auch. Da führt die Belastung, die man erlitten hat, wie beispielsweise eine Kriegserfahrung oder Vergewaltigung, nicht dazu, dass das Immunsystem stärker, sondern dass es fortwährend schwächer wird. Das ist aber zum Glück die Ausnahme. In der Regel werden Menschen durch Belastungen kleinerer oder mittlerer Art stärker, wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, lernbereit sind und sie in unser Leben integrieren können.
„Ein Immunsystem hingegen kann sich entwickeln und uns besser machen.”
Hier fällt oft der Begriff Resilienz, auch wenn ich den Begriff nicht sonderlich mag. Resilienz ist ein gutes Prinzip, um zu verstehen, dass wir widerstandsfähig sind und in Kontakt mit der Außenwelt eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickeln können. Dem Begriff Resilienz sind nur gewisse Grenzen unterworfen, weil Resilienz ein Begriff ist, der aus der Bauphysik kommt und die statische Abprallfähigkeit von Festkörpern beschreibt. Das trifft auf Menschen eben nicht zu, denn sie behalten ihre Form nicht, sie verändern sich. Man bekommt Ecken und Kanten und es bricht etwas weg, woanders kommt etwas dazu. Wir entwickeln uns. Und Ziel des Lebens kann es eben nicht sein, immer in die gleiche Form zu springen, in der man war, sondern vielmehr sich zu verändern, besser und stärker zu werden. Das alles beinhaltet der Begriff Resilienz nicht, deswegen mag ich ihn nicht ganz so gerne. Ein Immunsystem hingegen kann sich entwickeln und uns besser machen. Das ist auch bei mir und meinen lieben Patienten sowie Leserinnen und Lesern das Ziel: Wie kann ich das Immunsystem gemeinsam entdecken und was können wir tun, um es zu schützen und zu stärken?
Sie gehen außerdem darauf ein, dass wohlwollende Mantras alleine nicht stärker machen, Sie sagen, dass das alleine den Menschen nicht stärker macht, und gehen dabei auf ein physikalisches Grundprinzip ein und sprechen vielmehr von einer Transformation, die die Belastung in uns auslöst. Was hat es damit auf sich und vor diesem Hintergrund mit stimulierenden Reizen, Irritation, Gleichgewicht, Anpassung und dann Reifung bzw. Wachstum zu tun?
Wir brauchen den Kontakt mit der herausfordernden Außenwelt. Wenn wir uns immer wegducken, etwas klein hoffen, es uns bequem und kuschelig machen und ein größtmögliches Ausmaß an Sicherheit um uns herum knüpfen und nicht mehr herausgehen in die Welt, führt es nicht dazu, dass wir stärker werden. Das führt eher dazu, dass wir immer abhängiger werden von Sicherheiten, die uns ein anderer geben muss. Das wäre so, als würden wir in den Mutterleib zurückgehen, wo es kuschelig warm war. Da konnte uns nichts passieren. Aber das ist natürlich kein Leben jenseits der neun Monate. Rauszugehen und sich bewusst mal in Ungewissheiten zu stürzen, ganz bewusst mal etwas zu wagen, also ich im Sinne eines kalkulierten Risikos, keine Lebensgefahr, sondern bewusst Dinge zu versuchen, wo man so ein bisschen über seinen Schatten springen muss und die ein bisschen unbequem sind, wo es ein bisschen kitzelt und wo es einen ein bisschen reizt – das sind eigentlich die Dinge, die uns weiterbringen. Der Mensch braucht den Reiz, nur das stößt in unserem Inneren eine Gegenreaktion an. Deswegen haben die Griechen von „Hormesis“ gesprochen. Ich vergleiche das in dem Buch mit dem Eiswasserbaden. Wenn Sie in 25 Grad warmes Wasser gehen würden, passiert nichts, weil das warm oder zumindest nicht unangenehm ist. Dann gehen Sie wieder raus und es hat überhaupt keine Anstoßreaktion gegeben. Wenn Sie hingegen in Eiswasser gehen, also 5–6 Grad, dann macht das etwas mit uns. Es ist sehr lustig und macht viel Freude, aber es stößt auch etwas an. Es stärkt das körperliche Immunsystem tatsächlich und führt zu einer Verbesserung, beispielsweise für die Durchblutung. Das verändert den Organismus, weil der Reiz so stark war. Und dieses Eiswasserbaden im übertragenen Sinne brauchen wir im Leben häufiger. Deswegen ist es wichtig, dass Kinder beispielsweise von den Eltern nicht ständig protegiert werden und dass ihnen nicht alles an Herausforderungen abgenommen wird, sondern dass sie bewusst etwas wagen, dieses Eiswasserbaden im Leben immer wieder haben.
„Es ist ganz wichtig, wenn wir stark werden wollen und in Zeiten von Krisen nicht sofort umkippen möchten bei einem Windstoß, dass wir in uns so etwas wie Selbstvertrauen und Stärke entwickeln. Das kann man nirgendwo runterladen oder kaufen, sondern man muss es entwickeln…”
Dass sie beispielsweise eben vielleicht wirklich selber organisieren, wie sie von der Schule nach Hause kommen, wenn der Bus ausfällt. Oder dass es dann auch mal lernt, selber zum Bäcker zu gehen und Semmeln zu holen ab einem bestimmten Alter, und die Mama oder Papa einem das nicht abnehmen aus Angst, dass ein Massenmörder lauern könnte und ein Kind überfällt. Damit projizieren wir ja nur unsere Ängste auf das Kind, machen das Kind aber nicht stark, sondern das Kind lernt auf diese Weise nur, dass alles immer gemacht wird von außen und es verlässt diesen Mutterleib nicht im übertragenen Sinne. Es ist ganz wichtig, wenn wir stark werden wollen und in Zeiten von Krisen nicht sofort umkippen möchten bei einem Windstoß, dass wir in uns so etwas wie Selbstvertrauen und Stärke entwickeln. Das kann man nirgendwo runterladen oder kaufen, sondern man muss es entwickeln, dadurch, dass man rausgeht, das war Ihre Frage, und sich immer wieder den Herausforderungen stellt. „Hormesis“: immer wieder diesen Reizzustand suchen, also das Eiswasserbaden im übertragenen Sinne. Das ist ja nur ein Bild, eine Metapher für etwas, wo man sich in eine unliebsame, ja ich will nicht sagen gefährliche, aber doch reizvolle Situation bringt, die alles andere als bequem ist. Aber das ist wichtig, um stärker zu werden. Und damit haben wir, glaube ich, in den letzten 20–30 Jahren ein bisschen Probleme gehabt. Das haben wir viel zu wenig gemacht.
Das empfehle ich jedem, sehr früh, in jedem Alter, nachzuholen oder immer wieder zu tun, weil uns das stärker macht und nicht – wie Sie gesagt haben – selbst beweihräuchernde Mantras oder die Rückseite von Abrisskalendern durchlesen, wie toll wir alle sind, oder irgendwelche Seminare besuchen, wo uns jemand in den Kopf irgendwelche Botschaften gibt: Man muss nur auf der Toilette 20 Sekunden lächeln und dann ist die Welt wieder gut. Das alles bringt gar nichts, sondern nur Lebenserfahrung, raus ins Leben zu gehen, Reizzustände zu erleben und sich am Ende des Tages klarzumachen: „Hey, Mensch, war ja gar nicht so schlimm, habe ich geschafft. Mensch, klasse, merke ich mir, so schlimm ist das gar nicht, dann habe ich beim nächsten Mal weniger Angst davor.“ Es geht ja auch nicht darum, Kinder oder sich selbst in immense Gefahren zu bringen, sondern an unsere Stärke zu appellieren, die jedem von uns innewohnt. Ich glaube, dass jedes Kind, jede Frau, jeder Mann unterm Strich Probleme viel besser lösen kann, als es einem selbst bewusst ist. Und das lernt man eben nicht auf der Couch vor Netflix oder in Situationen, wo ich erwarte, dass die Politik mir mein Leben sicher machen soll, sondern indem ich es selber organisiere, indem ich mit meinen Nachbarn bestimmte Absprachen habe, indem ich in meinem regionalen Umfeld Sicherheit schaffe. Ich bin selber dafür ein bisschen verantwortlich und dann gelingt es uns auch als Gesellschaft. Die Politik macht das nach außen, das ist ihre Aufgabe, aber sie kann nicht bewirken, dass ich mich in meinem Herz sicherer fühle.
Wir hängen oft an den Lippen von Wissenschaftlern und Politikern in der Hoffnung, dass sie mir meine Sicherheit schenken, die ich für mein kleines Leben brauche. Das ist aber naiv. Ich muss es selber organisieren für mich und für meine Menschen, für die ich Verantwortung übernehme, also meine Kinder und meine Patienten und Kollegen. Jeder kann da etwas zu beitragen und das ist etwas, was wir können. Und wir müssen das, glaube ich, wieder zurückentdecken. Wir haben das in den letzten dreißig Jahren zu sehr externalisiert, sagt man, also nach außen gerichtet, das müsst ihr machen. Die Versicherungsgesellschaften, die Renten. Die Außenwelt musste Sicherheit für mich herstellen. Das ist aber total krank und albern. So sind wir nun ein bisschen geprägt worden. Ich habe das in dem ersten Kapitel beschrieben. In keinem Land gibt es so viel Versicherung wie in Deutschland. Ich glaube, – wie war das?! – 2700 bis 2800 Euro geben wir im Schnitt jedes Jahr für Versicherungen aus. Es gibt bei uns Versicherungspolicen für die geringsten wahrscheinlich eintretenden Ereignisse. Das zeigt einfach, dass wir nicht gelernt oder verlernt haben, selbstbestimmt mit Risiken umzugehen. Und das müssen wir jetzt dringend wieder lernen, weil ich glaube, um noch einmal vielleicht einen Link zur Politik zu knüpfen, in einer Welt, die so schnell veränderlich ist und in der wir jetzt wirklich Zeit aufholen müssen, werden wir auch Risiken eingehen müssen, davon bin ich überzeugt. Sonst werden uns andere überholen. Und dieses deutsche Sicherheitsbedürfnis, wir bewegen uns erst, wenn die Sache felsenfest und bombensicher ist, das werden wir aufgeben müssen, vermute ich.

Bild: © Prof. Dr. Volker Busch, Fotograf Oliver Reetz
Ich finde auch, wenn wir das klar kommunizieren würden, was Sie auch ganz am Anfang gesagt haben mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, würde man auch mehr in die Eigenverantwortung kommen. Dass man den Menschen mehr beibringt, es selber zu tun, und auch den Handlungsspielraum lässt. Wir hatten ja noch nie so viele Regularien und Gesetze und es wird alles bestimmt. Wenn man da ein bisschen mehr Spielraum bekäme, glaube ich, würden die Menschen das auch wieder anders lernen…
Absolut! Ein gesunder Menschenverstand ist hier das Stichwort. Es kann nicht sein, dass ein Mann erfolgreich eine Fluggesellschaft verklagt, weil er keine SMS bekommen hat, dass das Flugzeug an einem anderen Gate startet. Das muss doch im eigenverantwortlichen Handeln eines Menschen sein, sich selber zu erkundigen, wo mein Flugzeug abfliegt. Ich weiß nicht, wie der Fall ausgegangen ist, aber dass man es schon versucht, zeigt doch, dass wir in uns anscheinend ein Denken entwickelt haben nach dem Motto: „Die Mama macht‘s, aber in keinem Fall ich selbst!“ Und das ist einfach hanebüchen. Oder das Coronabeispiel, wo und wie wir Maske zu tragen hatten. Das hat die Politik entschieden und bei uns war es so, wie den eigenen Verstand wie eine Jacke an der Garderobe abzugeben. Da wünsche ich mir eine gewisse Ruhe und Sachverstand. Ich hoffe, dass wir das lernen, aber da bin ich ja zuversichtlich als Psychiater (lacht).
Sie sagen: „Lassen Sie den Kopf nicht hängen, wenn Ihnen das Wasser bis zum Gehirn steht!“ Wir haben Krisen im Alltag, Gewissheiten gehen verloren, Mutlosigkeit macht sich breit. Viele sagen: „Früher war alles besser.“ Dabei ziehen Sie aber zu Beginn ein Beispiel aus New York von vor 150 Jahren heran, wo eine Patientin ähnliche Symptome aufwies „wie wir heute“. Es ist von einer unerklärlichen Nervenschwäche, American Nervousness/Amerikanische Nervenschwäche bzw. Neurasthenie die Rede, vermutlich ausgelöst durch die neuen technologischen Errungenschaften von damals. Wie können wir es auf unsere heutige Zeit übertragen und unser Gehirn wohlwollend unterstützen?
Also, der Mensch kann sich immer dann mit Veränderungen am besten einverstanden erklären, wenn er zusätzlich zur Veränderung auch etwas hat, was er bewahrt. Also zu jedem Change gehört das Keep. Das sind Gegensätze in der Psychologie, die sich augenscheinlich konträr gegenüberstehen, aber dann doch zusammengehören wie Ebbe und Flut. Das eine ist nichts ohne das andere. Und so ist es hier auch. Soll heißen, wenn Menschen sich verändern müssen, weil sie sich beispielsweise dem technologischen Fortschritt aussetzen und im Arbeitsleben durch künstliche Intelligenz viele Abläufe und so weiter anders gestaltet werden, dann bedeutet das Veränderung. Sie brauchen dann aber als Gegensatz auch etwas, was sie bewahren können, eine Bewahrungskultur. Deswegen sind in einer veränderlichen Gesellschaft Werte auch wichtig. Das ist kein konservatives Gequatsche von Leuten, die sich nicht verändern wollen würden, sondern es ist ein kluger Gegensatz zur Veränderung. Also ich will damit sagen, wenn Menschen sich viel verändern oder verändern müssen, tun sie es leichter, wenn sie auch etwas haben, was gleich bleibt, worauf sie sich verlassen können. Angefangen beim Gottesdienst, den viele ablehnen, vielleicht heute nicht mehr so ein gutes Beispiel. Aber dann vielleicht ein Stammtisch oder eine gute Beziehung, ein Hobby, vielleicht auch nur das Team im Büro, ein Chef, der verlässlich ist, vielleicht auch nur ein Hund, mit dem man immer wieder die gleichen Spaziergänge macht. Das können also ganz kleine Dinge sein. Aber der Mensch braucht Verlässlichkeit in einer veränderlichen Welt. Und das schließt sich nicht aus, sondern das ist Yin und Yang, Ebbe und Flut, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das gehört zusammen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Diskussion noch nicht ganz verstanden haben, weil es bei uns immer so ein Entweder-oder ist.
Entweder du veränderst dich mit und sagst dich von allen bisherigen Dingen los oder du bist konservativ und willst dich eigentlich der Zukunft nicht öffnen. Und das ist ja Quatsch. Das ist Unsinn. Es ist beides wichtig. Der Mensch hat beides in sich und braucht beides. Und in der Zeit der Neurasthenie drohten eben diese Werte, das Gleichförmige, wegzubrechen, weil alles im Fluss war. Es war alles in Veränderung. Und so etwas Ähnliches erleben wir gerade auch. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir versuchen, sowohl bei unseren Kindern als auch bei uns Erwachsenen so ein Stück weit wieder zu berücksichtigen, dass wir etwas haben und auch haben dürfen, was gleich bleiben kann und muss. Ganz konkret bei den Kindern der Corona-Zeit haben wir es gesehen. Das war ja für sie auch eine unglaubliche Veränderung. Keine Schule oder nur Online-Unterricht und die Eltern waren zu Hause und man durfte nicht mehr raus und so. Die haben sich leichter getan mit diesen schrecklichen Dingen, wenn sie beispielsweise bestimmte Dinge weiter genießen durften, dass Papa z. B. immer die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hat. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass es uns in Krisen, wenn die Welt sich verändert, leichter fällt, wenn wir Dinge bewahren können. Und bei den Kindern sehen wir das. Dann wissen sie: Okay, das Leben ist doch irgendwie gleich und alles in Ordnung und es kann weitergehen. Da sehen wir das sehr schön. Und bei uns Erwachsenen ist das genauso. Also Change und Keep sind sehr wichtig.
Viele Menschen fühlen sich matt, lustlos, erschöpft, sind wenig motiviert und kraftlos. Was sind denn weitere typische körperliche Symptome, durch die man bei sich selbst erkennen kann, dass etwas aus dem Gleichgewicht gerät? Was sind erste körperliche Reaktionen, auf die man achten sollte?
Das ist schwer, weil die Symptome, die man psychosomatisch haben kann, sehr unspezifisch sind. Also es können alle sein, aber sie können umgekehrt auch Ausdruck einer echten Erkrankung sein. Es gibt keine alleinigen Erkennungsmerkmale. Ein paar hatten sie genannt, wie Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Magen-Darm-Probleme, aber auch Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Rückenschmerzen. Das können alles Folgen von psychischen Belastungen sein, aber eben sehr unspezifisch, weil sie auch Ausdruck von etwas ganz anderem sein können. Das wären häufige Symptome. Und wenn man mehrere davon hat, diese sich erhöht haben und man findet gleichzeitig noch eine Belastung in seinem Leben, dann sollte man gucken, ob da ein Zusammenhang besteht. Das muss dann in der Regel aber die Fachfrau oder der Fachmann machen.
Sie haben in Ihrem Buch so einige Strategien und Quicktipps aufgezählt, die man für sich mal ausprobieren kann, wie man das Gleichgewicht wieder hinbekommt und das Gute findet und sich vor Negativem schützt. Was sind so 2–3, die Sie uns hier nennen können?
Der erste Tipp ist, dass man die Anzahl negativer Nachrichten, negativer Menschen und negativer Stimmungen um sich herum reduzieren und bewusst auch mal Nein sagen sollte, wenn sie sich unmittelbar vor einem auftun. Also Schutz suchen. Man muss nicht alles wissen, nicht alles erfahren. Man muss sich auch nicht mit jedem Menschen auseinandersetzen. Man darf Abstand nehmen. Diese Distanz ist wichtig, wie beim Immunsystem: Wir stecken uns leichter mit Viren an, wenn sie ständig um uns herum sind und jeder uns ins Gesicht hustet.
Zweitens sollte man immer die Aufmerksamkeit auf das Gute und Gelingende im Leben richten. Das heißt nicht, dass man die Augen vor dem Schlechten verschließen soll. Das wäre nicht günstig, denn nur dann kann man ja was verändern, wenn man das Negative sieht. Aber man darf den Tag mit etwas Positivem beschließen. Das sollte man auch, weil wir dann leichter zur Ruhe kommen und uns in der Nacht besser erholen. Studien zeigen, der Schlaf ist einfach erholsamer und tiefer, wenn wir ihn mit etwas Gutem beenden und nicht mit den schrecklichen Dingen der Welt. Auch im Alltag kann man versuchen, immer wieder die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was einem z. B. nach einer Mittagspause oder was einem am Vormittag gut gelungen ist, oder am Nachmittag, oder wenn man durch die Straße geht. Nicht nur das Schlechte wahrnehmen, sondern auch das Gute: Welchen freundlichen Menschen habe ich getroffen, welches Kompliment habe ich bekommen? Welche schönen Pflanzen sehe ich im Garten? Das können banale Dinge sein, aber wir können unsere Aufmerksamkeit trainieren, das Gute zu sehen. Und das halte ich für eine faire Bilanz wichtig, weil sich einfach sehr viel Gutes jeden Tag in unserem Leben ereignet. Unser Gehirn erinnert uns leider eben immer nur an den ganzen Mist.
„Wir müssen alle lernen, Geschichten auch anders zu erzählen.“
Und das Dritte ist, dass wir, glaube ich, alle lernen müssen – mich eingeschlossen – Geschichten auch anders zu erzählen. In den Medien erzählen wir die Geschichten immer so, dass wir das Negative sehen und aufreißen und schwere Wunden entstehen. Und dann lassen wir die Menschen mit diesen Wunden alleine, in der Hoffnung, es heilt schon irgendwie. Es interessiert die Medien nicht, wie eine Geschichte gut ausgegangen ist. Das Schlechte verkauft sich leider besser in einer Welt wie heute, wo uns so viele negative Nachrichten rund um die Uhr über die Welt erreichen. Diese werden aber alle nur aufgerissen und dann irgendwann in der Hälfte losgelassen. Das sind natürlich schon viele Wunden, die da entstehen, und vielleicht auch Narben. Insofern empfehle ich, das zu tun, was wir früher gemacht haben, wenn wir unseren Kindern Geschichten vorgelesen haben. Selbst wenn sie mal schrecklich waren, zu erklären, warum ist das passiert? Was hat der Held für eine Chance, doch noch die Geschichte zu wenden? Das hat den Kindern ja gutgetan, dann konnten sie einschlafen. Und das versuche ich z. B. als Arzt auch bei meinen Patienten: Geschichten gut zu Ende zu erzählen. Ich muss natürlich auch viel Schlechtes verkünden, aber was hat man dennoch für Möglichkeiten? Welche Türen stehen ihnen offen? Was kann man machen? Und ich versuche, jedes Patientengespräch mit etwas Gutem enden zu lassen, weil ich weiß, das nehmen sie mit, wenn sie mein Zimmer verlassen. Und das gibt Zuversicht. Und das könnte auch Politik erreichen, das können wir als Eltern machen, das können Lehrer mit den Schülern machen, das können Ärzte mit den Patienten machen. Dazu können wir alle beitragen.
Wir haben während unserer täglichen Wachzeit viele Tausend Gedanken. Das kann dazu führen, dass unser Geist hyperproduktiv ist. Wie können wir es dennoch schaffen, abzuschalten, das Grübeln zu beenden und zur Ruhe zu kommen – ohne sich dann schuldig zu fühlen?
Ich finde es sehr schön, wenn das jemand nutzt. Dinge wie Muskelrelaxation oder Gymnastikübungen und den Körper mit einzubeziehen, ist immer hilfreich. Für wen das nichts ist, der Yoga oder solche Dinge nicht mag, dem empfehle ich auch immer handwerkliche Tätigkeiten wie Basteln oder so, weil das hilft, die Energie vom Kopf abfließen zu lassen. Wir betätigen uns alle handwerklich viel zu wenig. Wir sind alle so geistig operierende Menschen am Schreibtisch vor dem Bildschirm und das führt natürlich dazu, dass wir zwangsläufig denken müssen. Wenn wir aber handwerken (jeder kennt das, der vielleicht Gartenarbeit macht oder so oder mit Tieren zu tun hat), hilft das automatisch, weniger zu grübeln. Also wieder die Hände zurückentdecken, es muss ja auch nicht schön oder perfekt sein, was man macht. Es geht darum, dass man handwerklich etwas tut und dann in so einen Flow kommt, weil das ein wunderbares Gegengewicht zum vielen Denken ist.
„Jeder von uns ist tief von diesem Wunsch beseelt: Komm, wir packen das an und wir wuppen das, und deswegen habe ich auch Vertrauen in die Zukunft.“
Können Sie mit uns einen kleinen Ausblick wagen, was es zusammenfassend braucht, um zuversichtlich die Zukunft zu gestalten, Ängste zu bewältigen und stark und stabil zu werden? Wie können wir in unserer Welt sicherer werden, damit das Morgen, ja, damit es eine bessere Welt wird?
Also ich glaube, wichtig ist die Botschaft, dass die meisten Dinge sich nicht so schlimm entwickeln, wie wir es befürchten. Viele Herausforderungen sind groß und es gelingt auch nicht alles. Das darf man auch nicht verschweigen, aber meistens lösen wir Probleme besser, als wir es glauben oder als wir es uns gegenseitig zugestehen, weil in uns diese Kräfte schlummern, Probleme zu lösen und aus der Welt zu schaffen. Das ist das, wo unser Belohnungssystem im Gehirn am meisten drauf anspringt: Ein Problem haben und es irgendwie lösen. Das machen Unternehmer in der Wirtschaft, das machen Politiker im besten Fall, das machen Lehrer, das machen eigentlich alle. Wir wollen etwas machen und sei es nur, wenn wir einen Garten gestalten. Wir wollen etwas schaffen, etwas bewirken. Das ist in uns angelegt und führt dazu, dass wir Probleme aus der Welt schaffen. Das vergessen wir jedes Mal, wenn wir vor einem neuen Problem stehen, was sich wie ein Godzilla-artiges Monster vor uns auftut. Wir denken, ab jetzt geht es den Bach runter. Das schaffen wir nicht, aber wir schaffen es trotzdem, weil der Mensch, jeder von uns, jede Frau, jeder Mann tief von diesem Wunsch beseelt ist: Komm, wir packen das an und wir wuppen das. Und deswegen habe ich auch Vertrauen in die Zukunft.
„Das gibt uns diese Kraft. Diese Erinnerung, dass das immer schon so war und dass das wahrscheinlich auch immer so sein wird, gehört in den Reisekoffer einer Gesellschaft, die sich auf den Weg macht.”
Wir sollten uns nicht so sehr die Probleme immer nur gegenseitig kommunizieren, sondern durchaus mal an die Vergangenheit erinnern, wie wir Lösungen gefunden haben. Das macht Mut für die Zukunft. Ja, und immer mit der Statistik, die ich eingangs sagte, dass zwei Drittel der Dinge sich in der Zukunft besser entwickeln, als wir es befürchten. Manchmal liegt es auch daran, dass wir uns mit Problemen schlichtweg arrangieren. Auch das kann ja eine Lösung sein, dass manches eben im Nachhinein nicht so schlimm kommt. Auch da appelliere ich gerne an Corona. Es war natürlich irgendwie kein wünschenswerter Zustand, dass die Gastronomien zu hatten. Das sollte so nicht bleiben. Aber die Leute haben mehr gekocht, haben mehr im Garten gemacht, man hat sich damit auch irgendwie arrangieren können für ein paar Monate. Der Mensch kann Probleme lösen und sich mit Dingen arrangieren. Das gibt uns diese Kraft. Diese Erinnerung, dass das immer schon so war und dass das wahrscheinlich auch immer so sein wird, gehört in den Reisekoffer einer Gesellschaft, die sich auf den Weg macht. Und das wünsche ich uns, dass wir uns daran erinnern und uns nicht so verrückt machen.
Hinweis: Durch bestimmte thematische Beiträge erfolgt keine medizinische Beratung. Nichts davon ist dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren oder zu behandeln. Die Eigenverantwortlichkeit wird betont. Unsere Inhalte dienen lediglich der Weiterbildung, Information und Inspiration. Bei physischen oder psychischen Problemen sollte professionelle Unterstützung aufgesucht und in Anspruch genommen werden. |
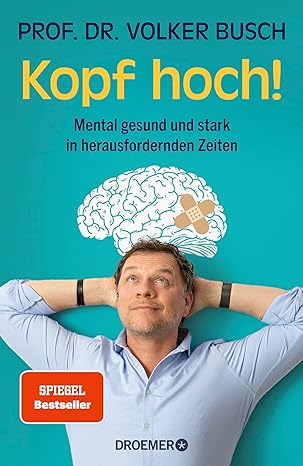
Prof. Dr. Volker Busch hat gerade das Buch “Kopf hoch!: Mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten” veröffentlicht. Sein Wissen und seine Erfahrung gibt er außerdem in Form von Keynotes/Vorträgen, Seminaren und Publikationen weiter, und hilft Führungskräften, Mitarbeitern und seinen Mitmenschen zu mehr Gehirngesundheit, Motivation und Inspiration. Er möchte an unsere Stärke appellieren, die uns innewohnt, und sagt: „Wir können selber viel mehr lösen. als uns selbst bewusst ist!”
Mehr darüber unter: www.drvolkerbusch.de
Buch: © Verlag DROEMER







